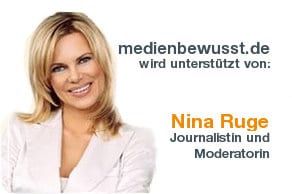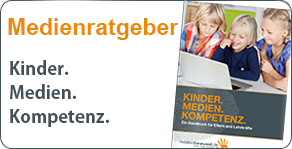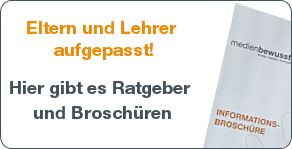Innenminister planen Verbot von „Killerspielen“
Bei der Innenministerkonferenz am vierten und fünften Juni in Bremerhaven einigten sich die 16 deutschen Innenminister auf eine Gesetzesvorlage für ein Herstellungs- und Verbreitungsverbot von „Killerspielen“. Aber was sind eigentlich „Killerspiele“?
In besagter Gesetzesvorlage werden diese als Spiele definiert, „bei denen ein wesentlicher Bestandteil der Spielhandlung die virtuelle Ausübung von wirklichkeitsnah dargestellten Tötungshandlungen oder anderen grausamen oder sonst unmenschlichen Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder menschenähnliche Wesen ist”. Ein kurzes aber eindeutiges Statement gab hierzu der niedersächsische Innenminister Uwe Schünemann (CDU) gegenüber der WELT: „Durch Killerspiele sinkt die Hemmschwelle zur Gewalt. Amokläufer haben sich vor ihren Taten immer wieder mit solchen Spielen beschäftigt.“
Auslöser für die erneut aufkeimende Diskussion über Gewalt in Computer- und Videospielen ist der Amoklauf von Winnenden im März dieses Jahres. Es existieren zwar bereits eine Vielzahl von Studien, die sich mit dieser Problematik beschäftigen, allerdings mit komplett unterschiedlichen Ergebnissen, welche oftmals sehr ideologiegeprägt und alles andere als objektiv sind. Fakt ist, es gibt keine wissenschaftlich fundierten Beweise, dass der von Herrn Schünemann behauptete Zusammenhang tatsächlich besteht. Andernfalls wäre auf unseren Straßen wahrscheinlich auch schon lange Krieg ausgebrochen, bedenkt man die durchaus große Anzahl von Menschen in Deutschland, die solche Spiele nutzen. Denn der Konsum von „Killerspielen“ ist unter männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu einem Massenphänomen geworden. Was auch erklärt, warum bisher jeder jugendliche Amokläufer bereits ein oder mehrere „Killerspiele“ gespielt hat. Doch diesen simplen, offensichtlichen Schluss haben die meisten deutschen Politiker noch nicht gezogen. Dabei muss man sich zwangsläufig die Frage stellen, ob überhaupt einer der Innenminister jemals ein solches „Killerspiel“ gespielt hat.
Eine sehr kontroverse Sichtweise vertritt beispielsweise der deutsche Neurobiologe und Hirnforscher Gerald Hüther: „Rund 40 Prozent der deutschen Schulkinder gehen mit Angst in die Schule. Vor allem die Jungs sitzen nach der Schule erst mal am Computer. Die brauchen mindestens ein, zwei Stunden Ballerspiele. Der Computer dient hier als Instrument zum Frustabbau. Indem sie in der virtuellen Welt Abenteuer bestehen, Monster abschlachten und zu Siegern werden, finden die Kinder aus der Ohnmacht, aus der angestauten Aggression heraus. Durch eine eigene Leistung bauen sie ihren Frust ab.“
Ein weiterer Aspekt, der oft sehr einseitig betrachtet wird, ist der Wandel den Computerspiele in den letzten Jahrzehnten durchgemacht haben. Sie sind realistischer geworden. Meist wird dabei nur die grafische Entwicklung betrachtet und natürlich zum Nachteil ausgelegt – man könne aktuelle Spiele viel schneller mit der Realität vermischen, weil Grafik und Effekte mittlerweile nahezu fotorealistisch aussehen und sich die Spielwelt physikalisch korrekt verhält. Natürlich wirken dadurch auch Bilder aus aktuellen Spielen abschreckender als noch vor einigen Jahren. Die Veränderungen betreffen aber ebenso das Spielprinzip. Mit den sinnlosen „Ballerorgien“ a la Soldier of Fortune oder Quake, wie sie noch vor zehn, fünfzehn Jahren üblich waren, hat heute kaum noch ein Spiel etwas gemein. Vielmehr muss man, selbst in vielen „Killerspielen“, an Gegnern vorbeischleichen oder mit Verbündeten interagieren. Bedenklicher sollte einen die beträchtliche Anzahl von Actionfilmen mit einer Altersfreigabe ab zwölf Jahren stimmen, in denen teils eindeutige, wenn auch geschnittene, Tötungsszenen zu sehen sind. Oder die unzähligen Gerichts- und Talkshows, die im Nachmittagsprogramm von so manchem Grundschulkind angesehen werden.
Natürlich sollten Kinder und Jugendliche keine Spiele nutzen, die nicht für ihr Alter bestimmt sind. Was die Alterseinstufung für Computer- und Videospiele angeht, hat Deutschland aber mit der USK jetzt schon eines der strengsten und ausgereiftesten Bewertungssysteme weltweit. Über eine schärfere Kontrolle der Einhaltung dieser Altersvorgaben muss sicher nachgedacht werden. Doch das Herstellungs- und Verbreitungsverbot von „Killerspielen“ setzt hier eindeutig an der falschen Stelle an. Bessere Bildung im Umgang mit Medien für Kinder und Jugendliche ebenso wie für die Eltern sowie die Bekämpfung sozialer Intoleranz und Ausgrenzung wurden von den Innenministern gar nicht erst in Betracht gezogen.
Die nicht ganz zeitgemäße Einstellung der Politik zu diesem Thema zeigt sich außerdem in der Tatsache, dass ein solches Verbot eine „Insellösung“ wäre. Im Zeitalter von Globalisierung und Breitband-Internetanschlüssen wird ein solches Gesetz die Verbreitung von Computer- und Videospielen mit Gewalthandlungen nicht verhindern können. Man wird lediglich eine Kriminalisierung der Spiele-Szene erreichen. Wohl aus diesem Grund ging der CDU-Bundestagsabgeordnete für den Kreis Heilbronn, Thomas Strobl, noch ein Stück weiter. Kurz nach der Innenministerkonferenz forderte er die Prüfung einer Ausweitung der geplanten Internetsperre für Kinderpornographie auf Killerspiele. Sollte es vor den Wahlen im September nicht mehr zu einer Abstimmung im Bundestag kommen, halb so schlimm, ein willkommenes Wahlkampf-Thema ist es in jedem Fall. Bleibt zu hoffen, dass der jetzt schon aufkeimende Widerstand gegen die Gesetzesvorlage der Innenminister ausreichen wird, die Umsetzung dieser zu verhindern. Denn das geplante Gesetz schießt eindeutig über das Ziel hinaus. Nach Paragraph 131 StGB sind gewaltverherrlichende Spiele in Deutschland schon seit längerem verboten. In der Praxis bedeutet das, ein Richter kann jederzeit ein Spiel prüfen, für gewaltverherrlichend befinden und es damit komplett aus dem Verkehr ziehen.
Neben der Diskussion um ein „Killerspiel“-Verbot zog man jedoch auch einige sinnvolle Schlüsse aus dem Amoklauf von Winnenden. So wurde bereits Ende Mai vom Bundeskabinett eine Verschärfung des Waffenrechts beschlossen. Weitere Schritte wie die schärfere Kontrolle von Waffenbesitzern oder auch ein deutschlandweites, onlinegestütztes Waffenregister sind bereits geplant. Schließlich kann man einen Menschen nach wie vor nur mit einer echten Waffe und nicht mit einem Computerspiel erschießen.
Philipp Carl
Bildquellen:
2008 Copyright byRockstar Games
Ice Age 3 – Die Dinosaurier sind los
Nach den großen Erfolgen der ersten beiden Teile konnte es nur eine Frage der Zeit sein, dass ein dritter Teil in die Kinos kommt. Drei Jahre nach dem zweiten Teil ist es nun soweit: Ice Age 3 macht sich auf den Weg, die Kinocharts zu erobern.
Katharina Rietz – Das Gesicht hinter Schloss Einstein
Katharina Rietz ist Mitarbeiterin bei der Saxonia Media Filmproduktion, einem Filmproduktionsunternehmen aus Leipzig. Das besondere an ihrer Arbeit ist jedoch, dass sie die Produzentin der Kinder- und Jugendserie Schloss Einstein – Erfurt ist. In einem Interview berichtete sie uns über ihre Arbeit, die Jungdarsteller und die Zukunft der Serie.
Prof. Dr. Karlheinz Brandenburg
Professor Karlheinz Brandenburg, bekannt durch seine Mitarbeit an der Entwicklung des mp3 Formats, ist Leiter des Frauenhofer Instituts für Digitale Medien in Ilmenau. Im Januar des vergangenen Jahres eröffnete das Institut die Außenstelle Erfurt, die sich mit dem Themenkomplex Kindermedien beschäftigt. Neben zahlreichen Auszeichnungen im Laufe seiner Karriere wurde Professor Brandenburg im diesjährigen Europäischen Jahr der Kreativität und Innovation außerdem zu einem der Botschafter hierfür ernannt.
60 Jahre und zum Teil noch Kind geblieben
Hört man den Namen Otto Waalkes, dann denkt man automatisch an strapazierte Lachmuskeln. Er ist einer der besten Komiker die Deutschland hervorbrachte. Zu Recht kann man sagen, denn kaum jemand in diesem Gewerbe ist so vielseitig. Er ist ein begabter Komiker, Comiczeichner, Sänger und Schauspieler. Der gebürtige Ostfriese ist heute bereits 60 Jahre alt, aber kein bisschen ernster. Ein Teil des Comedian ist immer Kind geblieben.
Sei dein eigener Hörbuchproduzent!
„Drachenalarm, Drachenalarm! Alle Mann ins Haus. Drachenalarm, Drachenalarm, jetzt kommt ClauS!“ erklingt am Anfang jeder Variation der Geschichte um ClauS, den Drachen. Das Besondere an der Geschichte um ClauS ist, dass es sie in 64 Varianten gibt. Der Hörbuchbaukasten (www.hoerbuchbaukasten.de) ist so konzipiert, dass es drei Kapitel gibt: „Die Geburt im Spinat“, „Der Buchstabensalat als Namensfinder“ und „Die Erfindung der Drachenschrift“. Dabei haben die Kinder die Möglichkeit, für alle drei Teile jeweils vier verschiedene Variationen auszuwählen. Anschließend können sie sich ihr Werk anhören oder gleich auf ihren mp3-Player speichern.
Programmtipps für Juli 2009
Im Sommermonat Juli treibt einen die Hitze gerne mal ins kühle Haus und vor den Fernseher, denn auch für diese Zeit bietet die Flimmerkiste ein buntes Programm. Aber nicht nur die Kinder können sich eine Auszeit gönnen. Damit Sie nicht stapelweise Fernsehzeitschriften wälzen müssen und auch die Füße hochlegen können, recherchierte medienbewusst.de die Highlights des Monats.
Eltern sollten die Kinder ins Internet begleiten
Dr. Christine Feil ist seit 1979 am Deutschen Jugendinstitut in München tätig. Im Rahmen ihrer Arbeitsgebiete Medienforschung und Medienpädagogik konzentriert sich die Diplom-Soziologin auf die Internetnutzung von Kindern. Von 2004 bis 2006 beobachtete sie mit ihrem Team im Rahmen des Projekts „Lernen mit dem Internet. Beobachtungen im Grundschulalltag“ die Internetnutzung in Grundschulen. Im Interview erzählt sie darüber und wie das Internet Kindern beim Lernen helfen kann.
Nachts im Museum 2
Nach dem fulminanten Erfolg von „Nachts im Museum“ war das Erscheinen einer Fortsetzung nur eine Frage der Zeit. Drei Jahre nach dem ersten Teil ist „Nachts im Museum 2“ nun in den deutschen Kinos zu sehen. medienbewusst.de hat sich das Museumsabenteuer für Sie angesehen.
AD(H)S und Computerspiele – Chance oder Risiko?
Diagnose: AD(H)S. Immer mehr Eltern verhaltensauffälliger Kinder sehen sich mit diesem Krankheitsbild konfrontiert. Kaum eine andere Krankheit hat in den letzten Jahren für so viel öffentliche Diskussionen gesorgt wie die Aufmerksamkeitsstörung mit oder ohne Hyperaktivität.
Unterstützer

- Hören
- Sehen
- Alltagserlebniss Fernsehen
- Alterseignungen für Fernsehsendungen
- Brauchen Kinder Fernsehen?
- Disney-Klassiker neu vertont
- Erotik und Sexualität im Fernsehen
- Fernsehen für Anfänger
- Fernsehen mit Migrationshintergrund
- Gänsehaut oder Lachkrampf beim Fernsehen?
- LEGO Ninjago
- Nachhaltigkeit in TV-Medien
- Nachrichten für Kinder
- Netflix Kindersicher machen
- Scripted Reality
- Suizid auf Netflix
- Vom Film zum Musical
- Vor- und Nachteile von Castingshows
- Lesen
- Interaktiv
- Lernen
- Ratgeber
- Abofalle
- Cybergrooming
- Cybermobbing
- Die Geschichte der Medien
- Generation Porno?
- Geschlechterstereotypen
- Konsumzeit Weihnachten
- Moodmanagement
- Nachrichtenkompetenz
- Onlinewerbung
- Rechtsextremistische Propaganda im Netz
- Selbstverletzung im Internet
- Verharmlosung von Essstörungen
- Warum Sexting unter Jugendlichen (k)ein Problem ist
- Wenn Eltern überfordert sind
- Wie viel ist zu viel?